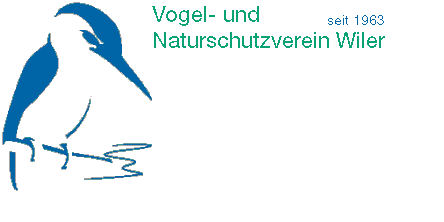Arbeitseinsatz im Grossen Moos
(Bilder sind hier zu finden)
Eine Delegation von fünf Freiwilligen reiste am Samstag, 6. Februar 2016 nach Kerzers. Ein Arbeitseinsatz fand im Gebiet Grosses Moos und Stausee Niderried statt. Dieses Gebiet hat für den Rotmilan und andere Arten internationale Bedeutung. Es wurde daher als IBA (Important Bird and Biodiversity Area) ausgewiesen. Zugunsten von Steinkauz, Kiebitz, Feldlerche, Dorngrasmücke und Grauammer läuft aktuell ein Förderungsprojekt. Dieses ist eine Zusammenarbeit des SVS/BirdLife Schweiz, der Berner Ala, des OV Kerzers, der IBA-Gruppe Grosses Moos und Stausee Niederried sowie des Berner Vogelschutzes BVS mit seinen Sektionen. Es läuft unter dem Titel: „National Prioritäre Kulturlandvögel im Grossen Moos BE/FR 2015-2019“.
Der Steinkauz
Der Steinkauz braucht offenes Gelände für die Jagd. Eine Weiden- und Heckenlandschaft bietet dem Kauz Tagesverstecke sowie Sitzwarten. In ausgefaulten Kopfweiden findet er natürliche Bruthöhlen. Extensive Wiesen oder Weiden sollten daran angrenzen, damit der kleine Eulenvogel genügend Nahrung finden kann. Das Nahrungsspektrum des Steinkauzes ist umso grösser, je abwechslungsreicher die Vegetation ist. Langgrasige Flächen und kurzrasige oder sogar vegetationslose Bodenstellen bieten ideale Bedingungen für das Vorkommen von Beutetieren und die Nahrungsbeschaffung des Vogels.
Damit der Bestand an Steinkäuzen wachsen kann, ist eine Aufwertung der Lebensräume und der Landschaft nötig. Buntbrachen und extensive Wiesen müssen gefördert werden, Kleinstrukturen, Sträucher und Niederhecken angelegt und gepflegt. Künstliche Niströhren können als Bruthöhlenersatz in alten Kopfbäumen dienen.
Was wir über Kopfweiden gelernt haben
Früher wurden Kopfweiden hauptsächlich als Brennholzlieferanten und für das Flechten von Körben genutzt. Sie gehörten über Jahrhunderte hinweg zum Bild unserer Kulturlandschaft.
Kopfweiden haben heute kaum noch eine wirtschaftliche Bedeutung. Und da sie eine regelmässige Pflege benötigen sind sie nach und nach verschwunden.
In jüngster Zeit hat die Kopfweide allerdings wieder einigen Aufschwung erhalten.
Ökologischer Nutzen
Vielerorts hat man erkannt, dass Kopfweiden unser Landschaftsbild bereichern. Sie prägen unsere oft ausgeräumte Landschaft langfristig. Kopfbäume haben Charakter und sind ein Blickfang in der Landschaft – gesunde und kräftige ebenso wie abgestorbene und schaurige.
Das Gehölz eignet sich sehr gut zur Ufer- und Hangabsicherung. Richtig eingesetzt verhindert oder verlangsamt es Erosionserscheinungen.
Die Pflanzstreifen sind aber vor allem auch von ökologischer Bedeutung. Sie vernetzen Lebensräume miteinander.
Kopfweiden mit ihren vielen Ritzen, Spalten und Höhlen bieten unzähligen Tierarten einen Lebensraum. Der hohe Totholzanteil und vor allem die Kombination von lebendem und morschem Holz in unterschiedlichen Zerfallsstadien ist von grösster ökologischer Bedeutung.
Die Kopfbäume selber stellen einen Lebensraum für viele Lebewesen dar. Insekten, Schnecken, Vögel, Steinmarder und sogar Fledermäuse finden in den ausgefaulten Spalten und Höhlen einen Unterschlupf. In den Nischen und Löchern der knorrigen Köpfe alter, hochstämmiger Kopfbäume finden viele Höhlen- und Nischenbrüter ein Zuhause. Vogelarten, die auf diese Nist- und Ruheplätze angewiesen sind, sind zum Beispiel die Hohltaube, der Grauschnäpper, Bachstelzen, Feldsperlinge, verschiedene Meisenarten, Baumläufer, Spechte, Garten- und Hausrotschwanz aber auch seltenere Arten wie der Steinkauz, der Wiedehopf oder der Wendehals.
Die knorrigen Bäume gehören zu den insektenreichsten Pflanzen überhaupt. Die zahlreichen Krabbel- und Flattertiere stellen eine wichtige Nahrungsquelle für viele Tiere dar. Vor allem Vögel profitieren von diesem Angebot. Aber auch das Tot- und Mulmholz selber wird verwertet. Es dient einer Vielzahl an Käfern, Fliegen, Tausendfüsslern, Asseln und Faltern (respektive deren Larven) als Futter. Hornissen nutzen den Mulm als Baumaterial für ihre Brutstätte.
Schmetterlingsarten wie der Trauermantel (Nymphalis antiopa) und der Grosse Schillerfalter (Apatura iris) haben sich auf Weidenblätter spezialisiert. Die Weidenkätzchen spenden Honig für Wild- und Honigbiene. Zu guter Letzt ist die Weide auch für den Biber eine beliebte und wichtige Nahrungquelle.
Damit noch nicht genug. Auch einige Pflanzen siedeln sich auf Kopfweiden an. Flechten, Moose und Pilze besiedeln die Bäume. Aber selbst grössere Pflanzen wie Holunderbüsche, Weidenröschen, Bittersüsser und Schwarzer Nachtschatten, Taubnessel, Brombeere und Stachelbeere sind regelmässig zu finden. Farne, Brennessel, Löwenzahn und die Gemeine Nelkenwurz sind weitere Vertreter der Flora, die in den mit nährstoffreichem Mulmhumus gefüllten Nischen Fuss fassen.
Kopfweiden stecken und pflegen
Jede Kopfweide war einmal ein simples Steckholz. Am schnellsten schlägt der Steckling Wurzeln, wenn er etwa 70 cm in den Boden getrieben wird. Weiter ist es für das Wachstum des Baumes förderlich, einen Ring aus Sand um den Steckling anzulegen. Im April-Mai schlägt die Weide aus. Anfang Juni muss der Kopf „definiert“ werden. Am einfachsten ist es, den Steckling auf Schulterhöhe zu köpfen – so ist er später jeweils auch ohne Leiter gut zu erreichen und der Schnitt erleichtert sich. Um den Kopf auszubilden, benötigt der Baum 4-6 „Augen“, welche austreiben können. Alle anderen Seitentriebe werden mit einem scharfen Messer oder einer Baumschere so nah wie möglich am Stamm abgeschnitten.
Zur Kopfweide kann man verschiedene Weiden „erziehen“. Am besten eignen sich aber die Weiss- oder Silberweide (salix alba) und die Bruchweide (Salix fragilis).
Schädlinge
Der Weidenbohrer legt seine Eier in nicht fachgerecht geschnittene Weidentriebe. Sind die Schnittflächen nicht sauber oder wurde der Trieb zu lang stehen gelassen, ist dies eine Einladung für den Falter, seine Eier abzulegen. Hat er dies getan, schlüpft aus jedem Ei eine Larve, welche bis zu vier Jahre im Stamm des Baumes verbringt, bevor sie sich verpuppt. In dieser Zeit frisst sie sich durch das Holz und fördert gleichzeitig das Pilzwachstum. Der Baum stirbt ab.
Schnitt / Pflege
Der Schnitt der Bäume erfolgt alle 2-3 Jahre, denn dann sind die Triebe noch nicht zu stark (dick) und die „Wunde“ kann sauber verheilen. Optimal ist es, die Triebe im November, direkt nach dem Laubabwurf, zu schneiden. Er ist dann in der Ruhephase und verliert keine wertvollen Kraftreserven.
Mit der Motorsäge kann man die Triebe kürzen. So kann verhindert werden, dass ein Ast nicht während dem Schnitt durch sein Gewicht abbricht und einreisst. Jedoch muss der Endschnitt per Hand erfolgen und technisch sauber ausgeführt werden, will man ein gutes Resultat erzielen. Bis zu fingerdicke Triebe können mit der Baumschere entfernt werden, dickere Triebe sägt man mit der Handsäge etwa 1.5-2 cm über dem Astkragen (Wulst) rechtwinklig zum Ast ab.
Julia Mathys